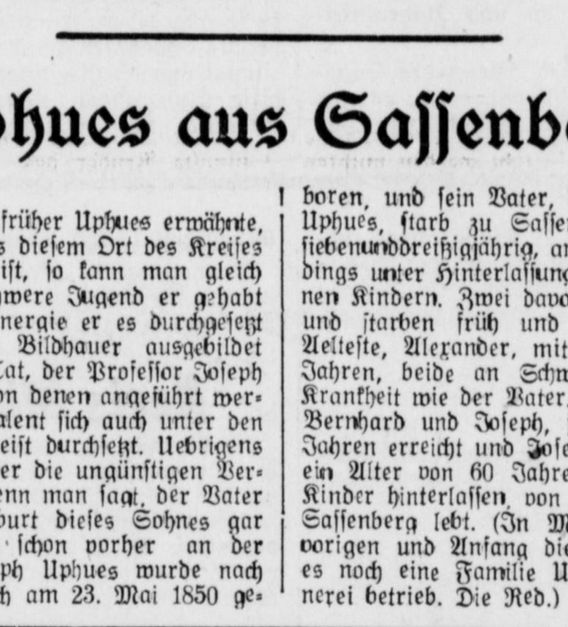"Joseph Uphues aus Sassenberg 1850-1911" aus "Die Glocke", 23.-28.05.1940
Joseph Uphues aus Sassenberg 1850-1911
I
Wenn man in Sassenberg früher Uphues erwähnte, den größten Künstler, der aus diesem Ort des Kreises Warendorf hervorgegangen ist, so kam man gleich darauf zu sprechen, welch schwere Jugend er gehabt und mit welch ungeheurer Energie er es durchgesetzt habe, dass sein Talent als Bildhauer ausgebildet werden konnte. Und in der Tat, der Professor Joseph Uphues könnte als Beweis von denen angeführt werden, dass ein ganz großes Talent sich auch unter den schwierigsten Verhältnissen meist durchsetzt. Übrigens werden die Behaup-tungen über die ungünstigen Verhältnisse noch übertrieben, wenn man sagt, der Vater des Künstlers habe die Geburt dieses Sohnes gar nicht mehr erlebt und sei schon vorher an der Schwindsucht gestorben. Joseph Uphues wurde nach dem Sassenberger Kirchenbuch am 23. Mai 1850 geboren und sein Vater, der Privatsekretär Bernhard Uphues starb zu Sassenberg an der Schwindsucht siebenunddreißigjährig am 18. November 1851, allerdings unter Hinterlassung einer Witwe mit vier Kindern. Zwei davon waren auch recht kränklich und starben früh und unverheiratet, nämlich der Älteste, Alexander, mit 30 Jahren, Maria mit 43 Jahren, beide an Schwindsucht, also derselben Krankheit wie der Vater. Ge¬sünder waren die Söhne Bernhard und Joseph, jener hat ein Alter von 57 Jahren erreicht und Joseph, der berühmte Bildhauer, ein Alter von 60 Jahren. Aber nur Bernhard hat Kinder hinterlassen, von denen noch eine Tochter in Sassenberg lebt. (In Meppen gab es Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts bzw. gibt es noch eine Familie Uphues, die eine Kunstschreinerei betrieb. Die Red.) Wie kam die Familie nach Sassenberg? Sie soll aus Ostfriesland stammen. Nach den Sassenberger Aufzeichnungen ist Alexander Uphues, aus Osnabrück kommend, im 18. Jahrhundert in Sassenberg und begründet hier eine Gärtnerei; seine Ehefrau, geborene Kenteler, stammt aus Borgloh bei Osnabrück. 1814, wird ihm, er wohnt auf der Schlossstraße, ein Sohn Bernhard geboren, der Vater des Künstlers, und schon dieser Bernhard ist künstlerisch begabt, und zwar musika¬lisch, er ist Organist und komponiert auch. Von Beruf ist Bernhard Uphues in Sassenberg das, was man heute Amtssekretär nennen würde. Diesen Titel hat er allerdings nicht, sondern er nennt sich Privatsekretär, denn er ist beim damaligen Amtmann Wessel von diesem privat angestellt, was natürlich zur Folge hat, dass bei seinem frühen Tode die Witwe, die mit den vier kleinen Kindern zurückbleibt, keinen Anspruch auf irgendwelche Witwenpension hat. Dabei ist der Grund¬besitz der Familie nur recht klein. Aber so schwächlich Mann und Kinder sind, so lebenskräftig ist diese Frau Katharina geborene Austermann, Tochter des Kleider-machers Godfried Austermann und der Anna Maria Mersmann zu Sassenberg, an der Füchtorfer Chaussee. Als die Witwe später wünschte, dass ihre einzige Tochter, die kränkliche Maria, den Kostgänger, der bei ihr wohnte, den Seilerge¬sellen Nitske heiraten sollte und sich weigerte, heiratete sie ihn selbst! Von seiner mutter muss Joseph Uphues die Energie geerbt haben, mit der er sich im Leben durchsetzte, während vom Vater das künstlerische Talent stammt, das sich dann wieder auf Neffen von Joseph vererbt hat.
Zunächst war bei Joseph an die Ausbildung des Talentes nicht zu denken. War es doch schon ein Wunder, dass die Witwe sich mit ihren vier kleinen Kindern über¬haupt durchbrachte. Joseph wurde zunächst Modellschreiner, machte eine ord¬nungsgemäße Lehre durch und ging als Geselle nach Holland. Dort, in Rotterdam, staunte man über seine Begabung als plastischer Künstler und riet ihm dringend, sich als Bildhauer auszubilden. Die gediegene handwerkliche Ausbildung als Mo¬dellschreiner hatte ihm natürlich in keiner Weise geschadet. Außerdem hatte er in seiner Rotterdamer Zeit einiges Geld erspart. Dass er nur einen westfälischen Bildhauer wählen konnte, stand für ihn als Sassenberger fest, und so ging er zu dem Bildhauer Goldkuhle in Wiedenbrück als Erwachsener nochmals in die Lehre. Wiedenbrück ist bekannt durch seine Kunstwerkstätten und eine künstle¬rische Tradition, die seit Jahrhunderten in dieser Stadt lebendig ist. In Goldkuhle hatte Uphues offenbar einen Meister, bei dem er sehr viel mehr lernen konnte als in einer anderen kleinstädtischen Bildhauerwerkstätte. Das zeigte sich schon sehr bald. Während vielfach in Deutschland die kleinstädtische Bildhauerei ein Handwerk geworden und die Kunst nur noch auf den Akademien zu finden war, erhielt Uphues in Wiedenbrück so viel künstlerische Anregung, dass ein Krieger¬denkmal von ihm, irren wir nicht, so war es für die Stadt Büren, angefertigt, all¬gemeines Aufsehen erregte. Aber ohne „Akademismus“ ging es nun mal nicht in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Uphues zog nach Berlin und wurde Schüler der Berliner Akademie und Meisterschüler von Reinhold Begas, einem der berühmtesten Bildhauer seiner Zeit. Glocke 23.5.1940 Nr. 138
II
Es gibt Kunstkritiker, die die Kunst von Reinhold Begas schon als Anfang einer ge¬wissen Entartung ansehen. Sein Konkurrent und Gegner Hildebrand, der „Das Problem der Kunst in der bildenden Form“ schrieb, ein grundlegendes Buch über Plastik, erklärte Plastiken von Begas zuweilen als sehr geschickt, aber der Bestimmtheit entbehrend. Es ist für uns nicht ganz einfach, über diese Periode zu urteilen, da sie noch nicht so weit zurückliegt. Den Klassizismus fand man ein-getrocknet, man wünschte jedenfalls in der jüngeren Generation eine lebensvollere Naturauffassung. Die heranwachsende Generation bannte nun Reinhold Begas in seinen Kreis durch sein großes Talent, allerdings warf man, ob zu Recht oder Unrecht kann hier nicht untersucht werden, zuweilen manchem der Begasschüler geschwollenen Naturalismus vor. Im Allgemeinen kämpfte ja in dieser Zeit Klassizismus mit Naturalismus, zuweilen griff Begas zurück auf Bernini und den Barock. Die Antike soll uns Vorbild, aber keine Grenze sein, das war da eins der Hauptschlagworte jener Periode. Das Studium der Natur sollte sich mit dem der Antike begegnen. Auf der Berliner Kunstausstellung von 1885 stellte Joseph Uphues eine Plastik aus, einen italienischen Knaben, der Gipsfiguren zum Verkauf ausruft. Die Figur erregte Aufmerksamkeit und Beifall und wurde in einem Ausstellungsbericht der Zeitschrift für bildende Kunst lobend erwähnt, des¬gleichen auch eine Porträtbüste des Sassenberger Künstlers, an der die feine Individualisierung in demselben Bericht gerühmt wird.
Uphues arbeitet dann mit an dem Werk seines Meisters Begas: der Raub der Sa-binerinnen, dem berühmten Begasbrunnen, und schafft dann persönlich die gruppe des seine Schwester verteidigenden Sabiners. Der Sabiner und seine Schwester sind streng in einem Dreieck aufgebaut, ein künstlerischer Gedanke, den Michelangelo schon gehabt hat, der außerordentlich wirksam ist. Die Kritik der Ausstellung von 1887 lobt das dramatische Leben der Figuren und das am Studium der Antike geläuterte Formgefühl. Grade hierdurch unterscheidet sich Uphues von manchem anderen Begasschüler. Der Bildhauer Schaper, der auch um dieselbe Zeit an der Akademie in Berlin wirkt und dem wüsten Treiben der Naturalisten entgegentritt, scheint hier auf Uphues Einfluss genommen zu haben. Die von Uphues ausgestellten Werke haben ihn 1888 schon so berühmt gemacht, dass die größte Stadt Australiens, Melbourne, in diesem Jahre eine Plastik des Sassenberger Künstlers, die einen Bogenschützen darstellt, für ihr Museum ankauft. Aber auch in der Heimat entstehen ihm Kunstmäzene, nicht im Münsterland, wo sich außer seinem früheren Spielgefährten Professor Adrian Schücking (Pyrmont) niemand um ihn kümmert, sondern im Rheinland. Die weit¬hin bekannte Familie Schöller in Düren verschafft ihm den Auftrag für ein Kaiser¬Wilhelm-Denkmal in Düren. 1891 wird dieses Denkmal enthüllt, und nun ist Uphues mit einem Schlage durch dies Werk in die Reihe der großen Denkmal¬bildner des wilhelminischen Zeitalters eingerückt. Er hat gezeigt, dass er stand¬feste Figuren schaffen kann, bei denen das Problem der Form aus dem Block heraus gedacht ist, wie Hildebrand es in seiner berühmten erwähnten Schrift verlangt.
Kein Wunder, dass das Auge Kaiser Wilhelms auf diesen Mann fällt. Als der Stadt Berlin die Siegesallee zur Erinnerung an die ruhmreiche Vergangenheit des brandenburg-preußischen Staates geschenkt werden soll. 1895 werden 15 Künstler aufgefordert zu entwürfen, um Standbilder der Fürsten Brandenburgs und Preußens zu schaffen. Das „falsche Gebiss der Berolina“ hat man später diese Reihe von Denkmälern aus carrarischem Marmor genannt, dieser blendend weiße Marmor gehöre unter die italienische Sonne und nicht unter den Berliner Himmel. Diese lange Allee von Denkmälern von unerträglicher Weiße hat soviel Widerspruch erfahren, dass sie jetzt nicht mehr besteht. Schon die ganze Anord-nung, dass bei jedem Herrscher zwei bedeutende Vertreter seiner Regierungszeit dargestellt werden mussten, hatte etwas Schematisches und Unkünstlerisches an sich. So musste Uphues neben Friedrich dem Großen Bach und den Marschall Schwerin, neben dem Grafen Otto von Brandenburg, den Edlen von Putlitz und den Geschichtsschreiber Heinrich von Antwerpen, einen Kleriker, darstellen. Dabei handelte sich um Personen aus dem Jahre 1200, bildliche Darstellungen waren also wohl kaum vorhanden. Geheimrat Koser suchte die Persönlichkeiten aus und gab die wissenschaftliche Begründung der Auswahl. Lehnen wir also vom künstlerischen Standpunkt vom künstlerischen Standpunkt heutzutage diese Siegesallee als solche rundweg ab, so schließt das nicht aus, dass einzelne der Standbilder von hohem künstlerischem können zeugen. Vor allem gilt dies von den Denkmälern unseres Sassenbergers. Uphues war, wie alle, die ihn persönlich gekannt haben, bezeugen, ein edler Idealist, ein Mensch von großer Güte, und er legte sein edles Empfinden in seine Werke. Deshalb ist dieser Markgraf Otto, den er für die Siegesallee scbuf, solch edler Mann.
Glocke 24.5.1940 Nr. 39
III
Der Markgraf Otto wird aber weit übertroffen von dem Standbild Friedrichs des Großen. Altmeister Adolf von Menzel, der am meisten von Darstellungen aus friderizianischer Zeit verstand, hat sich sehr lobend über dieses Monument aus-gesprochen. Uphues hat noch mal einen Friedrich den Großen geschaffen für den Park von Sanssouci, außerdem ein solches Monument für die Stadt Schweidnitz.
Das erstgenannte Denkmal des großen Friedrich wurde in Bronze kopiert und von Kaiser Wilhelm den Vereinigten Staaten von Amerika geschenkt, die, sobald sie den Krieg erklärt hatten, aus dem Metall des Denkmals Munition machten! So fand es ein merkwürdiges Ende. Der junge Friedrich erregte in seiner graziösen Vornehmheit überall derartige Bewunderung, dass schon bei der Denkmalsent¬hüllung Uphues vom Kaiser einen Auftrag zu einem Moltkestandbild auf dem Berliner Königsplatz erhielt. „Aber keine Zoologie dabei“, hatte der Auftraggeber gesagt, und Uphues schuf ein Denkmal in strengster Einfachheit ohne die damals üblichen zoologischen Ensembles, aber auch ohne Putten und Genien. Viele Kritiker haben dies Standbild Moltkes auf dem Königsplatz für das beste und reifste erklärt, was Uphues geschaffen hat. Freunde des Künstlers, die den ersten Entwurf gesehen haben, den Kaiser Wilhelm, was das Piedestal anging, umgestal¬tete, und zwar gegen den Willen des Künstlers, behaupten, dieser erste Entwurf sei noch besser als der ausgeführte gewesen. Feinheit der Charakteristik und geistige Vertiefung, das war das große Können des Sassenberger Künstlers. So gab er dem jugendlichen Friedrich die vornehme Erscheinung des jugendlichen Philosophen von Sanssouci in eleganter Lässigkeit des Äußeren, so gab er die Gestalt von Moltke bei all ihrer monumentalen und strengen Würde doch mit einem intimen Zug, wie der Dargestellte ihn hatte, wenn er im Reichstage einer Rede Bismarcks lauschte oder im Generalstab sich Vortrag halten ließ. Dabei traf er die ruhige, vornehme Würde, die menschliche Größe und den persönlichen Zauber des großen Schlachtenlenkers in einer Weise, die allgemein Anerkennung fand. Es ist schon gesagt, dass die Familie Schöller in Düren Uphues so sehr förderte. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass der Sassenberger Künstler für die Stadt Düren außer dem schon erwähnten Bildnis Wilhelms I. ein Moltkestand¬bild schuf, ferner aber in dieser Stadt verschiedene Kirchhofsdenkmäler und Por-traitbüsten. Weshalb, fragen wir, hat denn für Sassenberg und Warendorf, für Münster und die Provinz Westfalen dieser große Künstler, den das In- und Ausland anerkannte und feierte, niemals einen Auftrag gehabt? Weshalb hat ein westfälischer Kreisausschuss oder Provinziallandtag den Sohn der Heimat, der zu den berühmtesten Künstlern des Vaterlandes zählte, niemals durch einen Auftrag geehrt? Das ging wunderbarerweise damals nicht. Uphues hatte eine evan¬ge¬lische Frau geheiratet, sogar die Tochter eines evangelischen Pastors, eine sehr gebildete, künstlerisch veranlagte Dame, die als Pianistin Ruf genoss und in Berlin das Haus von Uphues zu einem Zentrum schöngeistiger Geselligkeit machte. Des¬halb war die Persönlichkeit von Uphues im Münsterland „untragbar“! Diese finstere Zeit ist für immer vorbei. Ein Heimatgenosse, der ihn förderte, war dagegen der einstige Sassenberger Spielgefährte, der Professor Schücking, Bade¬arzt in Bad Pyrmont, als die Badeverwaltung beschlossen hatte, in der Allee eine Büste von Lortzing aufzustellen, der dort so viel gewandelt und komponiert hatte. Die Anfertigung der Lortzingbüste wurde Uphues übertragen, und die Büste erwies sich als trefflich gelungen. In vorzüglicher Weise gerecht wurde Uphues einem Auftrage für das Reichspostmuseum, das marmorne Standbild des Reiches ersten deutschen Generalpostmeisters Dr. Heinrich v. Stephan zu schaffen. Uphues hatte ihn nie gekannt, die überaus beweglichen Züge von Stephans waren schwer in Marmor festzuhalten. Um so erstaunter war man über die Lebens¬¬wahrheit und Ähnlichkeit des Werkes von Uphues. Auch das Grabdenkmal für den Postminister v. Stephan schuf Uphues, ebenso das für den berühmten Geschichtsprofessor v. Treischke und eine große Reihe von Marmorbüsten, wovon nur die der Professoren Aegidi, Dr. Weber, des Ehepaars Schöller, der Sängerin Mary Münchhoff genannt sein sollen.
Auch bei einer nur kurzen Schilderung des Lebens und der Werke von Joseph Uphues darf nicht unerwähnt bleiben, was er auf Veranlassung der Kaiserin Friedrich schuf. Dreimal hat Uphues den Sieger von Wörth dargestellt, im Hom-burger Park, in Wiesbaden und in Charlottenburg. Als Uphues das erste Mal den Auftrag erhielt und in seinem Atelier tätig war, erschien bei ihm die Kaiserin Friedrich und bat den Künstler, der ihr einen Entwurf zeigte, ob sie diesen in Bezug auf die Gesichtszüge etwas verbessern dürfe. Uphues, der keine Ahnung davon hatte, dass die Kaiserin selber modellierte, gab sehr zögernd die Erlaubnis und war dann hocherstaunt, als sein Besuch den Spachtel ergriff und mit Meister¬schaft durch ganz geringfügige Änderung eine Korrektur vornahm, die die Gesichtszüge vollkommen lebensähnlich machte. Mit wenigen Strichen war das geschehen. Nach dem Tode der Kaiserin Friedrich wurde ihr Denkmal neben dem ihres Gatten in Homburg vor der Höhe aufgestellt, und wieder war es Uphues, der dieses Denkmal schuf. Das Charlottenburger ist ein großes Reiterstandbild. Für Wiesbaden hat Uphues übrigens auch ein Schillerdenkmal geschaffen.
So fehlte es Uphues nicht an großen Aufträgen, und sein Leben war sehr glück-lich, da er sich schon im dritten Jahrzehnt als Künstler restlos durchgesetzt hatte.
Dabei wurde er aber nie hochmütig und blieb als Professor immer derselbe bescheidene, liebenswürdige Mensch, der er als Tischlergeselle gewesen war, ein Mensch ohne Feinde, voll zartsinniger Menschenliebe, der sein großes Ein-kommen zu Werken der Wohltätigkeit verwendete, die er aber nach Möglichkeit verheimlichte. Trübe Stunden in seinem Leben hat jeder, und auch Joseph Uphues blieben sie nicht erspart. Hier soll nur vom Dürener Nuditätenstreit die Rede sein. Als Uphues das große Dürener Kaiser-Wilhelm-I-Denkmal schuf, sollten am Sockel zwei Frauengestalten Krieg und Frieden die Regierungszeit des großen Kaisers verherrlichen. Schon der Denkmalsausschuss machte den Künstler darauf aufmerksam, es dürfte kein nacktes Bein einer Frau dabei gezeigt werden, und Uphues musste das Bein einer der allegorischen Frauengestalten, das er nackt hervortreten lassen wollte, verhüllen. Als das Denkmal enthüllt wurde, erhob sich aus gewissen Kreisen Dürens ein Entrüstungssturm, der zu einem Zeitungskrieg ausartete, denn bei einer der erwähnten Frauengestalten war die eine Brust unbekleidet. Erst der öffentliche Hinweis darauf, was im Vatikan an unbekleideten Frauengestalten in dieser Beziehung zu sehen ist, beruhigte etwas die Dürener Nuditätenschnüffler. Uphues wird natürlich bald über solche Angriffe in der Öffentlichkeit gelacht haben, sie beweisen aber, wie ein Teil des Volkes vor 50 Jahren über Darstellungen des menschlichen Körpers dachte bzw. zu denken gelehrt war. Man kann sich heute eine solche krankhaft anmutende Auffassung kaum noch vorstellen.
Uphues hatte großen Humor und war ein außerordentlich geselliger Mensch. In seinem schönen Heim in Wilmersdorf vereinigten er und seine Frau, mit der er leider keine Kinder hatte, stets große Gesellschaften von Schriftstellern und Künstlern, Militärs und Beamten. Uphues war auch Jäger und hatte bei Berlin eine Jagd gepachtet, aber er war so fleißig und hatte soviel Aufträge, dass das Wild vor ihm meist Ruhe hatte. Bis nach Paris holte man den Künstler zu Portrait¬büsten. Der Verein Berliner Künstler und die Sezession standen sich damals meist feindlich gegenüber, aber Uphues war Mitglied bei beiden, und bei seiner Leichenfeier erschienen die Vorstände beider Vereine mit umflorten Fahnen und großen Trauerkränzen. Die Sezession vertrat dabei der jetzt so berühmte Bildhauer Klimsch. An einer Rippenfellentzündung verstarb Uphues ganz plötz¬lich am 2. Januar 1911. Nachrufe auf ihn brachten alle großen Zeitungen. Es be¬steht die Hoffnung, dass in Sassenberg der Heimatverein den großen Künstler durch eine Tafel an seinem Geburtshaus ehrt. Sassenberg würde sich selbst da¬durch ehren. Glocke 28.5.1940 Nr. 143